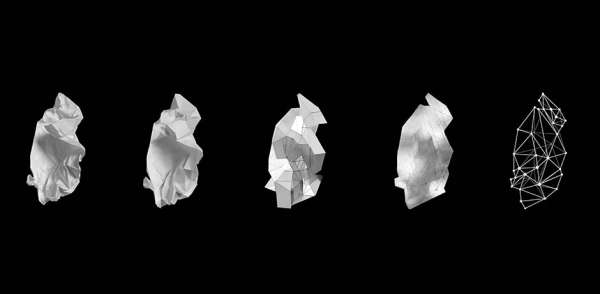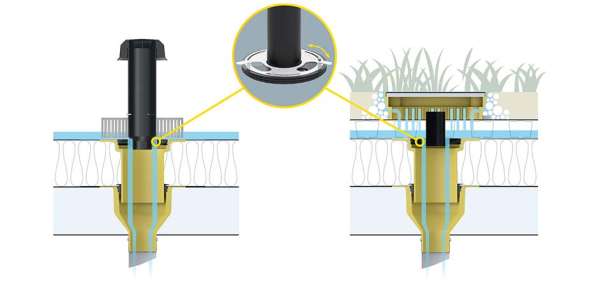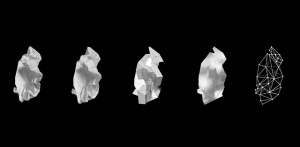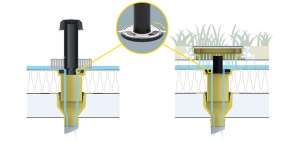Für gerade einmal ca. 10% der Studierenden ist derzeit ein Platz in einem Wohnheim vorhanden. Um mehr leistbares studentisches Wohnen in Wien gewährleisten zu können, bemüht man sich besonders auf diesem Sektor die Angebote des temporären Wohnens für Studierende kontinuierlich zu erhöhen.
Für viele stellt gerade am Anfang des Studiums das Studierendenheim das unmittelbare Lebensumfeld dar. Das soziale Umfeld, die Lage im städtischen Raum, die Nähe zu Bildungseinrichtungen, die Qualität der Unterbringung und natürlich die daraus resultierenden Kosten sind die Kriterien, mit den sich die Studsierenden (und – Tendenz steigend – auch deren Eltern) auseinandersetzen. Über die Jahre haben sich ihre Bedürfnisse und Ansprüche an das Wohnen allerdings stark verändert. Darauf will das „Raummodul für das Wiener Studentenheim“, das auf Grund von Umfragen unter den Studierenden entwickelt wurde, reagieren.
Aus der Sicht der Heimträger stehen nicht zuletzt die Kosten im Fokus, die mit dem Bauen und Betreiben der Wohnheime für Studierende verbunden sind. Wie setzen sich die Gesamtkosten eines Projektes zusammen? Welche Themen sind im Betrieb zu beachten? Sind die Bewohner dieser Einrichtungen mit der gebotenen Qualität zufrieden?
Eine Arbeitsgruppe – bestehend aus VertreterInnen der Akademikerhilfe, der WGA ZT GmbH und der TU Wien, Forschungsbereich Baugeschichte und Bauforschung – hat sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Thematik auseinandergesetzt und die Ergebnisse in dem vorliegenden Buch „Das Wiener Studentenheim“ publiziert. Es richtet sich an das Fachpublikum, aber auch an eine allgemein kultur- und wissenschaftsinteressierte Leserschaft.
Das Buch ist im Michael Wagner Verlag erschienen und kann bei dem Herausgeber Akademikerhilfe Studentenverein oder im Online-Handel bestellt werden.
INTERVIEW
Redaktion: Seit mehr als zehn Jahren ist die Erforschung des studentischen Wohnens in Wien aus bauhistorischer Perspektive ein fixer Forschungsschwerpunkt am Fachgebiet Baugeschichte und Bauforschung der TU Wien. Wie haben Sie zu diesem Forschungsprojekt gefunden?
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Marina Döring-Williams hat in den 2000er Jahren eine Publikation über die Baugeschichte des studentischen Wohnens in Berlin verfasst und wollte, nach ihrer Berufung an die TU Wien, diesem Thema auch in Wien auf den Grund gehen. Die bauhistorische und bautypologische Untersuchung verschiedener Bautengruppen ist ja auch ein wesentlicher Aufgabenbestandteil des Forschungsbereichs Baugeschichte und Bauforschung. Gemeinsam mit Studierenden sind wir im Zuge mehrerer „Forschung-in-der-Lehre“-Projekte baugeschichtlich in das Thema eingestiegen. Die Ergebnisse wurden 2013 in der Ausstellung „Studenten(da)Heim – Geschichte, Trends und Perspektiven des studentischen Wohnens in Wien“ präsentiert. Diese dreiwöchige Ausstellung, ein „ephemeres Museum“ mit gebauten historischen und aktuellen Raumsituationen des studentischen Heimwohnens und umrahmt von öffentlichen Fachvorträgen und Diskussionen zum Thema, war gleichzeitig eine wertvolle Austauschplattform für die unterschiedlichsten Akteure im Studierendenheimwesen, der Architekturbranche und Vertretern aus dem Bauwesen. Sie war Auslöser und Anfang für viele Folgeprojekte in der Forschung mit diversen Heimbetreibern und Architekturschaffenden.
Redaktion: Wie wichtig ist das Angebot zum studentischen Wohnen für die Lehre?
Harald Oissner: Einen direkten Einfluss auf die Lehre gibt es aus meiner Sicht nicht. Das Angebot ist aber deshalb von besonderer Wichtigkeit, weil viele Studierende, auf Grund ihrer Wohnentfernung zum Ort der Bildungseinrichtung, keine Möglichkeit haben, an ihrem Wohnort zu verbleiben. In weiterer Folge bietet das Wohnheim natürlich indirekte Auswirkungen auf die Lehre, weil durch gemeinsame Interessen der Bewohner natürlich auch hier positive Effekte eintreten können.
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Besonders spannend für Studierende ist die Tatsache, dass sie selbst die angesprochene Nutzergruppe darstellen, wenn es etwa um Entwurfsprojekte geht. Studentisches Wohnen birgt in sich auch ganz klar die Auseinandersetzung mit aktuellen Architekturthemen wie hybrides, temporäres Wohnen oder auch den „Tiny House“-Effekt. Sprich Konzepte aus dem Studierendenheimbereich beinhalten ganz viele aktuelle und auch experimentelle Konzepte.
Aber auch die historische Perspektive und das Bauen im Bestand ist ein sehr sehr gefragte und praxisnahe Themen für angehende ArchitektInnen und/oder BauforscherInnen. Vor kurzem initiierten wir erstmals sogenannte research.build -Projekte mit dem Fokus „forschungsbegleitendes“ Planen und Bauen zu vereinen. Das bedeutete einen nie dagewesenen Austausch von Forschung und Praxis in der Entwurfs- und Ausführungsphase, gewährte den Studierenden einen besonders praxisnahen Einblick, und schenkte gleichzeitig dem Bauherren einen zusätzlichen Mehrwert im Projekt.
Redaktion: Funktionieren die historischen Studentenheime heute genauso wie zur Entstehungszeit?
Bernhard Tschrepitsch: Grundsätzlich ja, denn es sind nach wie vor junge Menschen, die im Rahmen Ihrer Ausbildung ein Wohnbedürfnis befriedigen. Alle Studieren, alle haben die gleichen Sorgen, Wünschen und Freuden. Vielleicht ist der Anspruch auf Individuellen Komfort heute größer
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Nein, geht es um die Räumlichkeiten. Ja, geht es um den sozialen/gesellschaftlichen Charakter. Über die fast sieben Jahrhunderte hat sich das Spiel zwischen kollektivem und individuellem Miteinander stets gewandelt – abhängig von den jeweiligen universitären, politischen, gesellschaftlichen und sogar stadträumlichen Strukturen. Prinzipielle Bedürfnisse wie Schlafen, Essen, Lernen und das Schließen von Freundschaften mussten seit jeher abdeckt werden, wenn auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise.
Redaktion: Welche Wandlung hat studentisches Leben im Lauf der Zeit genommen?
Bernhard Tschrepitsch: Heute ist die Ausbildung vermehrt verschult. Die bedingt, dass unserer Meinung nach die Selbstorganisation und Selbstständigkeit tendenziell abnimmt. Auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten der Mobilität gestiegen. Programme wie Erasmus sind hier enorm wichtig. Auch die internationale Verknüpfung ist über technische Hilfsmittel – Internet – leichter geworden. Wahrscheinlich ist der Druck auf die Studierenden heute größer als früher.
Harald Oissner: Nachdem es im tertiären Bildungssektor, im Vergleich zu früher, deutlich mehr Bildungsangebote gibt, haben sich auch Veränderungen im studentischen Leben ergeben. Mit der Einführung von Fachhochschulen in Tages- und vor allem auch Abendformen hat es plötzlich auch Personen gegeben, die überhaupt kein „klassisches“ Studentenleben führen. Insgesamt ist durch einen größeren Druck auf die Studierenden das Gesamtsystem eher verschult worden. Dies bringt Vor- und Nachteile mit sich.
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Unbeschwertes studentisches Wohnen war und ist noch immer nicht zuletzt abhängig von der Verfügbarkeit eines erschwinglichen Wohnraums. Dass Wohnen auch den Faktor „Freizeitgestaltung“ berücksichtigen soll, kommt erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts und ganz allmählich ins Spiel. Die Epoche der mittelalterlichen Bursen war ja auf die Befriedigung nur der Grundbedürfnisse und einen eher „klösterlichen Ablauf“ konzentriert, die Jahrhunderte der „Studentenbuden“ durch das in die Gaststätten, Kaffeehäuser und Kneipen ausgelagerte Gesellschaftsleben geprägt. Momentan wandelt sich das Studierendenheimzimmer immer mehr vom „Mehrzweckraum“ zum privaten Wohnzimmer, Lernen und Arbeiten werden immer mehr ausgelagert. Spannend ist in diesem Zusammenhang daher auch der aktuell zu beobachtende Wandel der „Gemeinschaftsräume“. Lernräume gab es schon seit Beginn in den Wohnheimen., in der ersten Hälfte des 20. Jhs. Waren dann auch Räumlichkeiten zum öffentlichen politischen und diskursiven Austausch gefragt. Ab den 1980er Jahren fanden das Lernen und Arbeiten für das Studium aber verstärkt an den Unis selbst bzw. im privaten Zimmer statt. Jetzt geht seit einiger Zeit der Trend in den Heimen wieder in die Gegenrichtung, hin zu großzügigen Co-Working Spaces und allgemeinen Lernräumen. Und die „Partyräume“ sind heute ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der Heime mit Mythos-Potenzial.
Redaktion: Welche Wohnformen werden in modernen Wohnheimen nachgefragt?
Bernhard Tschrepitsch: Hier gibt es einen eindeutigen Nachfragetypus. Dieser wird in unserem Buch auch beschrieben. Es ist das Einbettzimmer, mit eigener Sanitäreinheit und Kochnische. Hier kann der Bewohner Individualität leben und selbstbestimmt Gemeinschaft „nutzen und daran teilnehmen“. Dies ermöglicht auch Freunde kurzfristig zu beherbergen und manchmal einen Partner „inoffiziell“ übernachten zu lassen.
Harald Oissner: Die Nachfrage ist eindeutig auf die Einzeleinheit mit der gesamten Infrastruktur fokussiert. Dies ist auch international zu beobachten. Es gibt immer wieder „Wohnexperimente“, bei welchen versucht wird, auch andere Typen zu entwickeln. Diese bleiben in der Regel aber Unikate.
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Laut den Betreibern wird vor allem das Einzelzimmer mit eigenem Bad, bevorzugt sogar das Einzelappartement inkl. Kochmöglichkeit nachgefragt. Ist hier der Wunsch nach möglichst viel Individualität augenscheinlich, bleibt dennoch zu hinterfragen, wie man in Zukunft mit dem von diesem Schema abweichenden Bestandsbauten und den sehr wohl vorhandenen Doppelzimmern oder Duplexeinheiten umgehen will. Und natürlich mit der Frage, inwiefern der Bautyp „Studierendenheim“ in einer Zeit, die nicht nur durch Individualisierung, sondern eben auch durch Tendenzen der Isolation und des nicht mehr ausreichend Wahrgenommen Werdens geprägt ist, Chance bieten kann, innovative Konzepte des Gemeinschaftlichen zu entwickeln. Auch solche, die zunächst mal nicht dem momentanen Ideal- bzw. Wunschbild der Nutzerinnen und Nutzer entspricht. Gibt es hier womöglich auch eine soziale und die Gesellschaft mitprägende Verantwortung der Häuser, jungen Menschen kollektives und offenes Bewusstsein mit auf den Weg zu geben? Hier zeigen einige jüngere experimentellere Beispiele durchaus interessante Ansätze. Und – nicht zu vergessen – gibt es in Wien ja als Paradebeispiel Anton Schweighofers Pionierprojekt, das Haus am Erlachplatz, das bereits in den 1990er Jahren mit den Konventionen brach und erfolgreich die Gemeinschaft wieder absolut in den Vordergrund stellte.
Redaktion: Skizzieren Sie uns grob den klassischen Studenten vor hundert Jahren und erläutern Sie uns welche Unterschiede zu heute bestehen?
Bernhard Tschrepitsch: Vor hundert Jahren waren Studenten nahezu zu 100% Männer, überwiegend Kinder von Bildungsbürgern. Egalitäre Strukturen waren kaum vorhanden. Mit dem Aufkommen der Studentenheime in Österreich, konnten das erste Mal Kinder bildungsferner Schichten überhaupt in die Möglichkeit einer tertiären Ausbildung kommen. Heute sind Frauen und Männer auf der Uni gleichverteilt. Die Massenuni ist nicht mit der elitären Einrichtung vor 100 Jahren vergleichbar. Die Herkunft der Studiereden rekrutiert sich nach wie vor stark aus einem akademischen Elternhaus. Nach der Phase der Aufmüpfigkeit in den 60er und 70er Jahren herrscht heute nahezu Mainstream, auch wenn viel von Individualismus gesprochen wird.
Redaktion: Wie wird sich studentisches Wohnen in der Zukunft entwickeln?
Bernhard Tschrepitsch: Es wird nach wie vor Studentenheime geben. Die Leistbarkeit des Wohnens wird für Teile der Studenten ein stärkeres Thema spielen. Auf der anderen Seite werden Sonderformen mit mehr Platz und hohen Preisen sicher auch Segment bilden. Vielleicht werden vermehrt Kinder auch im „Hotel Mama“ verweilen, aus Bequemlichkeit. Sicher ist aus unserer Sicht aber, dass auch zukünftig Studierende, die im klassischen Studentenheim wohnen, mehr Freude, mehr Freunde und in Summe eine schönere Studentenheimzeit haben werden, als ihre Kollegen in anderen Wohnformen.
Harald Oissner: Auch in Zukunft wird das Wohnheim für Studierende eine wesentliche Unterkunftsform bleiben. Das zeigt auch der Trend, dass viele gewerbliche bzw. freifinanzierte Wohnheimerrichter und Betreiber auf diesen Markt drängen. Die Leistbarkeit des Platzes wird eine wesentliche Frage sein. Daher ist es ganz besonders wichtig, dass die gemeinnützigen Heimbetreiber ihr Angebot auch in den nächsten Jahren weiter ausbauen.
Elisabeth Wernig/Marina Döring-Williams: Wie auch in den vergangenen Jahrhunderten wird sich das Spiel zwischen mehr oder weniger gewünschter oder ermöglichter Kollektivität wiederholen. Distance Learning oder das Bewohnen von einzelnen Mini-Appartements wird sich aber nicht auf den prinzipiellen Wunsch nach Austausch und einem Miteinander mit anderen Studierenden – vor allem als Neuankömmling in einer neuen Umgebung – auswirken. So bleibt zu hoffen, dass sich auch zukünftig sowohl Heimbetreiber als auch deren Bewohnerschaft auf mutige und auch experimentelle Konzepte einlassen. Denn wie die Baugeschichte zeigt, war das studentische Wohnen immer offen für Innovationen und Pionierprojekte und gilt nicht von ungefähr als Wegbereiter für andere Formen des temporären und kollektiven Wohnens.
Kurzvita

MMag. Bernhard Tschrepitsch, geboren in Wolfsberg/Ktn. Studium der Theologie und Betriebswirtschaft. Er beschäftigt sich intensiv mit dem Studentenheimwesen in Österreich und war maßgeblich an der Novellierung des Studentenheimgesetzes beteiligt. Zu diesem gab er auch einen Kommentar heraus. Bildquelle: Akademikerhilfe

Arch. Dipl.-Ing. Harald Oissner, geboren in Bad Vöslau in Niederösterreich, Studium der Architektur. Er kann auf eine 27-jährige Berufserfahrung im Bereich der Architektur- und Generalplanung und des Projektmanagements zurückblicken. Bildquelle: WGA ZT GmbH

Elisabeth Wernig (li) und Marina Döring-Williams (re). Bildquelle: Julia Totter
Marina Döring-Williams, Univ. Prof. Dr.-Ing. (Leitung Institut und Forschungsbereich), ist seit 2002 Universitätsprofessorin, Leiterin des Lehrstuhls für Baugeschichte und Bauforschung an der Technischen Universität Wien.
Elisabeth Wernig, Arch. Dipl. Ing. Projektass. ist seit 2019 Senior Architect bei MEISSL ARCHITECTS ZT GmbH (Büro Hallein) und seit 2021 selbständige Architektin.